Veranstaltungen 2016
![Das Bild zeigt Fascicularia bicolor, eine terrestrische Bromelie mit roten Hochblättern und türkisfarbenen Blüten [Foto H.Steinecke] 2016 Steinecke Foto02](/images/veranstaltungen/2016/2016_Steinecke_Foto02.jpeg) Vortrag von Dr. Hilke Steinecke
Vortrag von Dr. Hilke Steinecke
Mittwoch 20.01.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
Die Natur zeigt eine schillernde Palette verschiedenster Farben, wobei besonders Pflanzen eine große Farbvielfalt haben. Es werden wichtige pflanzliche Pigmente sowie ihre Bedeutungen für die Pflanzen vorgestellt. Was verbirgt sich hinter dem Geheimnis der bunten Blätter? Oder warum sind manche Blumen rot und andere blau gefärbt? Der Mensch macht sich Pflanzenfarben in vielerlei Hinsicht zu Nutze, z. B. zum Färben von Textilien und Lebensmitteln oder bei der Gestaltung von Gärten. Viele bunte Bilder bereichern den Vortrag.
Vortrag von Prof. Dr. Peter Prinz-Grimm
Montag 01.02.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
![Sehr gelungene Kombination zweier kontrastreicher tertiärer Gesteine in Ober-Högern: gelber Rockenberger Sandstein und dunkelgrauer Vogelsbergbasalt [Foto P.Prinz-Grimm] 2016 PrinzGrimm Tertiaergesteine](/images/veranstaltungen/2016/2016_PrinzGrimm_Tertiaergesteine.jpg)
Schon in ihren ältesten Kulturstufen haben sich Menschen mit Steinen beschäftigt und diese nach ihren Eigenschaften für bestimmte Zwecke verwendet. Feuersteine als Rohstoffe für allerhand Gerätschaften wurden über große Entfernungen mitgeführt, ja selbst Riesenblöcke der Megalith-Kulturen finden sich oft weit entfernt von ihrem Ursprungsort. Anders ist es mit den Gesteinen für den Haus- Kirchen- und Festungsbau: Diese wurden in unserem Raum seit der römischen Kolonisation in großem Volumen gebraucht und praktischerweise aus naheliegenden Steinbrüchen beschafft. So ergab sich über Jahrhunderte ein räumlicher Zusammenhang zwischen der regionalen Geologie und dem verwendeten Baustoff, der sich in einem harmonischen Bild des in den Bauwerken verwendeten Gesteinsbestandes äußert. Charakteristisch sind im Südosten der Wetterau die freundlichen roten Gemäuer aus Buntsandstein, aber auch die dunklen basaltischen Festungen im vulkanischen Vogelsberg, die wiederum im Kontrast stehen zu den strahlenden aber schroffen Bruchsteinbauwerken aus Taunusquarzit.
Naturbausteine sind haltbare und zeitlose Baustoffe. Allerdings steht die mechanische Bearbeitbarkeit im Widerspruch zur Verwitterungsresistenz, weshalb sich die richtige Verwendung nicht nur über ästhetische Vorstellungen sondern vor allem aus handwerklicher Tradition und praktischer Erfahrung ergibt. Über viele Jahre nagt der Zahn der Verwitterung an manchem Gestein und verlangt einen Ersatz, der unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten dem Bauwerk gerecht werden muss. Zu diesem Zweck ist es wichtig, die einstigen Herkunftsorte - in der Regel Steinbrüche – zu kennen, und diese gegebenenfalls für den erneuten Abbau verfügbar zu halten. Viel bedeutender ist jedoch das Ziel, zu einer naturraumbezogenen Ästhetik im Bauwesen zurückzufinden. Die Verwendung billiger, aus der ganzen Welt importierter Rohstoffe ist auf den Einzelnen bezogen durchaus verständlich, die Anlage moderner Siedlungen mag in der charakterlosen Vielfalt von Form und Material vielleicht praktisch für den Alltag sein, ist aber austauschbar und überaus langweilig. Erstrebenswert wäre die Bereitstellung und Förderung von lokalen Natursteinen, deren Gewinnung vor Ort durchaus ökologischen Ansprüchen genügen kann, deren Bearbeitung nach unserem sozialen Standard erfolgt und deren geringe Transportkosten der Umweltverträglichkeit dienen.
Vortrag von Martin Schroth
Mittwoch 17.02.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
In den Bergen Sloweniens und Kroatiens findet der Alpenbogen sein östliches Ende.
Die hohen Kalksteingipfel der Steiner Alpen mit prachtvollen Blumenalmen zeigen eine unglaublich artenreiche Alpenflora.
Weiter südlich in den wilden Karstgebieten des Nationalparks Velebit überlebten in abgelegenen, menschenfernen Wäldern sogar Braunbären und Luchse – auch Wölfe und Geier haben sich wieder angesiedelt.
Diese Region zählt zu den ursprünglichsten Ökosystemen Europas.
Das nahe Mittelmeer führt zu einem besonders attraktiven Klima, geologische Besonderheiten machen das Wandern in diesen weißen Kalkbergen zu einem unvergesslichen Erlebnis. In Nachbarschaft zu dem faszinierenden Landschaftsmosaik finden sich kleine Küstenstädtchen mit venezianischer Architektur und Bademöglichkeiten im kristallklaren Meer der Kvarner Bucht.
Lassen Sie sich inspirieren zu einem spannenden Natur-Erlebnis in dieser sonnenverwöhnten Region.
Vortrag von Walter Malkmus
Montag 07.03.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
"Im Land der Mitternachtssonne - Naturfaszination Lappland" - Wanderungen auf dem schwedischen Kungsleden (Königsweg) durch das Naturreservat Vindelfjäll.
Referent Walter Malkmus (Partenstein) entführt die Zuhörer mit einem digitalen Bildervortrag in den hohen Norden Europas nach schwedisch Lappland. Auf einer zehntägigen Wanderung auf dem bekannten Kungsleden (Königsweg) geht es durch das riesige Naturreservat Vindelfjäll mit seiner unberührten, eiszeitlich geprägten Naturkulisse aus Hochgebirge, Fjäll, Birkenwäldern, Flusstälern, Mooren und Seen. Eine reiche Frühlingsflora, Rentierherden, eine faszinierende hochnordische Vogelwelt und traumhafte Mitternachtssonnen-Stimmungen lassen die Wanderung zu einem unvergesslichen Naturerlebnis werden.
Vortrag von Dr. Yvonne Walther
Mittwoch 16.03.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
![Langohrfledermaus [Foto Y.Walther] 2016 Walther Langohr1](/images/veranstaltungen/2016/2016_Walther_Langohr1.jpg)
Obwohl wir in unserem Siedlungsraum Fledermäuse beobachten können, stellen die Wälder den eigentlichen Lebensraum der heimischen Fledermausarten, die allesamt stark gefährdet und streng geschützt sind, dar. Viele Arten leben sogar ausschließlich im Wald. Daher ist das Vorkommen einer Vielzahl an Fledermausarten ein bedeutender Hinweis auf die ökologische Wertigkeit eines Waldes. Zum Erhalt von mittlerweile selten gewordenen alten Laubwaldbeständen mit hoher faunistischer Bedeutung, die als sogenannte Kernzonen aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen werden sollen, versucht die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz im Main-Kinzig-Kreis seit 2012 u.a. mit Hilfe von Fledermauserfassungen solche reifen Waldbestände zu identifizieren.
Bei der Fledermausuntersuchung im Spessart wurden 2014 mehrfach Kolonien der Mopsfledermaus nachgewiesen. Eine Art, die in Hessen noch bis vor 15 Jahren als ausgestorben galt. Aufgrund der überraschenden Ergebnisse konnte 2015 mit tatkräftiger Unterstützung der BI „Windkraft im Spessart – Im Einklang mit Mensch und Natur“ eine vertiefte Erfassung dieser Fledermausart durchgeführt werden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mopsfledermaus als einzige Vertreterin ihrer Gattung, bisher unbekannte Verhaltensmuster aufweist und besondere Lebensraumansprüche benötigt. Gleichzeitig ist ihr Vorkommen ein Indiz für großräumige unzerschnittene Räume, daher ein Qualitätsanzeiger für den Spessartwald. Der Vortrag will Interessantes über die Lebensweise der Waldfledermäuse im Allgemeinen, und die Mopsfledermaus im Speziellen vermitteln.
Dienstag 22.03.2016, 19:30 Uhr, Franz-Weber-Raum im Kulturforum Hanau
Zur Mitgliederversammlung wird mit gesonderter Post eingeladen.
   |
Die 3. Hanauer Naturkundetage 2016 sind dem Schwerpunktthema Auen "Entstehung, Klimawandel, Naturschutz" gewidmet. Sie beinhalten einen zweigeteilten Vortragstag und insgesamt vier Exkursionen an verschiedenen Tagen.
|
→ Zu den Naturkundetagen sind Bildergalerien und ein Bericht verfügbar.
Vortrag von Prof. Dr. Hans-Rudolf Bork (Institut für Ökosystemforschung, Universität Kiel)
Samstag 09.04.2016, 19:30 Uhr, Hohe Landesschule
![Auf der Suche nach dem 1000jährlichen Niederschlag [Foto H.-R.Bork] Auf der Suche nach dem 1000-jährigen Niederschlag](/images/veranstaltungen/2016/2016_Bork_Foto01.jpg) 21.07.1342 - 28.02.1784 - Wann kommt das nächste Extremhochwasser? Die Wirkungen von Wetter, Klima- und Landnutzungswandel auf die Hochwasserentstehung.
21.07.1342 - 28.02.1784 - Wann kommt das nächste Extremhochwasser? Die Wirkungen von Wetter, Klima- und Landnutzungswandel auf die Hochwasserentstehung.
Welchen Einfluss haben Menschen auf die Entstehung von Hochwasser? Nach den Untersuchungen vergangener Hochwässer durch den Vortragenden ist die Antwort eindeutig: einen hohen! So veränderte im Juli 1342 das Hochwasser eines außergewöhnlich starken Niederschlages die Täler von Donau, Neckar, Main, Lahn, Rhein, Weser, Elbe und Eider. Ablagerungen bezeugen die Dramatik, das Ausmaß und die Folgen der bei weitem verheerendsten Flut des vergangenen Jahrtausends. Seine Ursachen führen uns in den Mittelmeerraum. Das stärkste Winterhochwasser der vergangenen Jahrhunderte ereignete sich Ende Februar 1784; um es zu verstehen, blicken wir bis nach Island. Können ähnlich dramatische Ereignisse heute und in den kommenden Jahrzehnten erneut auftreten? Hans-Rudolf Bork versucht vor dem Hintergrund des Klimawandels einen Blick in die Zukunft.
Vortrag von „Extrembotaniker“ Jürgen Feder
Montag 02.05.2016, 19:30 Uhr, Hohe Landesschule
 Jürgen Feder: Der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde zählt zu den bekanntesten Experten für Botanik in Deutschland und ist Autor bzw. Co-Autor diverser Bücher, Fachzeitschriften und von inzwischen mehr als 600 Fachartikeln zum Thema Flora.
Jürgen Feder: Der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde zählt zu den bekanntesten Experten für Botanik in Deutschland und ist Autor bzw. Co-Autor diverser Bücher, Fachzeitschriften und von inzwischen mehr als 600 Fachartikeln zum Thema Flora.
Der begeisterte Naturforscher war nach seiner Ausbildung zum Landschaftsgärtner und seinem Studium der Landespflege lange Zeit als selbständiger Landespfleger und Chef-Pflanzenkartierer tätig.
Jürgen Feder vermittelt auf leicht verständliche Art sein Fachwissen und verhilft dem Thema Botanik auf diese Weise zu mehr Bekanntheit und Popularität. Sein Enthusiasmus für die Pflanzenwelt und seine authentische Art sich auch für die unscheinbarsten Gewächse zu begeistern, sind mitreißend und fesseln selbst Zuschauer ohne „grünen Daumen“.
In seinem neuen Vortrag „Feders Pflanzenjahr“ wirft Jürgen Feder auf seine unvergleichliche Art einen Blick auf sein persönliches Pflanzenjahr 2015 zurück.
Foto: ©thorstenwulff
Führung mit Robert Anton im neuen Wissenschaftsgarten
Samstag 04.06.2016, 10:00 Uhr
Der neue Wissenschaftsgarten der Goethe-Universität in unmittelbarer Nähe der naturwissenschaftlichen Fachbereiche wurde im Zuge der 100-Jahr-Feierlichkeiten der Universität im Juni 2014 eröffnet. Er umfasst ein großes Gewächshaus, ein Versuchsgewächshaus, 8 Klimakammern und zurzeit rund 3 Hektar Freilandbereich. Der Wissenschaftsgarten ist der dritte Garten der Universität in ihrer 100-jährigen Geschichte und geht auf den 1763 von Johann Christian Senckenberg mit seiner Stiftung begründeten Garten zurück. Aufbau und Pflanzenbestand orientieren sich am aktuellen Lehr-und Forschungsbedarf. Der Landschaftsarchitekt und technische Leiter des Gartens Robert Anton wird durch die Gewächshäuser und über die Außenanlagen führen. Geschichte, Aufbau und Pflanzenbestand der Anlage werden hierbei erläutert.
Nach der Führung im Wissenschaftsgarten kann der nahegelegene Alte Flugplatz Bonames besucht werden. Dieser ehemalige Militärflugplatz ist seit Abzug der Amerikaner Landschaftsschutzgebiet und inzwischen die Heimat zahlreicher Tiere und Pflanzen.
Maximale Teilnehmerzahl: 25, Anmeldung bitte bis 18.05.2016
Kosten: 5 EUR
Anreise individuell, Treffpunkt um 10:00: Eingang zum Wissenschaftsgarten. Die Zufahrt erfolgt über die Altenhöferallee (http://www.uni-frankfurt.de/51838989/InformationenAnfahrt)
Fahrgemeinschaften möglich, dazu Treffpunkt um 9:00 am Schlossplatz in Hanau.
Exkursion mit Kerstin Bär und Dr. Michael Barth
Samstag 09.07.2016
![Blick in den Steinbruch an der Rauschermühle bei Niederkirchen [Foto K.Bär] 2016 Exkursion Pfalz](/images/veranstaltungen/2016/2016_Exkursion_Pfalz.JPG)
Am Straßenaufschluss bei Olsbrücken sind Übergänge zwischen verschiedenen Gesteinen des Rotliegend sichtbar. Zuerst wurden in Gewässern typische rote Ablagerungsgesteine des oberen Rotliegend gebildet. Diese wurden von einer mächtigen Lava überdeckt, die das Gestein im Kontakt durch Hitze verändert hat. Die Lava repräsentiert eine vulkanische Phase, wie sie im Rotliegend je nach Region und Zeitpunkt die Landschaft geprägt hat. Der Vulkanismus hatte an dieser Stelle den Lebensraum eines Sees zerstört.
In einem stillgelegten Steinbruch bei Niederkirchen sind Intrusionen von Magma in ältere Ablagerungsgesteine zu beobachten. Wir sehen hier einen Teil des „Unterbaus“ der Rotliegend-Landschaft. Weitere permzeitliche Aspekte erfahren wir entlang der Fahrtstrecke nach Thallichtenberg.
Am Nachmittag haben wir eine Führung im GEOSKOP. Der Leiter des Museums, Dr. Sebastian Voigt, hatte im Begleitprogramm unserer Perm-Ausstellung einen Vortrag über Spuren früher Saurier gehalten. Das Hauptobjekt seines Vortrages, eine große Fährtenplatte, steht vor dem Museumseingang. Das Museum selbst bietet spannende Einblicke in die Urgeschichte des Pfälzer Berglandes vor etwa 290 bis 260 Millionen Jahre. Außergewöhnlich gut erhaltene Fossilien und großformatige Lebensraumbilder geben einen lebendigen Eindruck von der Tier- und Pflanzenwelt im Zeitalter des Rotliegend. Außerdem belegen Mineralienfunde die historische Bedeutung des Bergbaus in der Nordpfalz.
Busexkursion. Treffpunkt Schlossplatz, Abfahrt 8:00, Rückkehr gegen 19:00. Festes Schuhwerk empfohlen.
Kosten für Bus und Museum: 40 EUR, Anmeldung bis 09.06.2016
Mittagspause auf Burg Lichtenberg: wahlweise Einkehr im Restaurant oder Rucksackverpflegung und Besichtigung des Burggeländes.
→ Zu beiden Teilen dieser Veranstaltung sind Berichte und Fotostrecken verfügbar.
Exkursion mit Prof. Dr. Thomas Kirnbauer
Sonntag 25.09.2016
![Stromatoporen auf der verwitterten Oberfläche eines Kalksteins, Hahnstätten/Ts. [Foto T.Kirnbauer] 2016 Exkursion Lahnmulde](/images/veranstaltungen/2016/2016_Exkursion_Lahnmulde.JPG)
Vor allem schwammähnliche Organismen, sog. Stromatoporen, nutzten die optimalen Wachstumsbedingungen und bauten bis zu 300 m mächtige Riffe auf. Aus den Riffkalken und Riffschuttkalken wurden im Laufe der Erdgeschichte Kalksteine, die heute in der Großstruktur der sog. Lahnmulde z.T. hervorragend aufgeschlossen sind. Der Begriff „Massenkalk“ geht auf die massige Ausbildung der Riffe zurück. So lässt sich z.B. häufig noch die typische Dreigliederung der Riffe in Vorriff (grober Riffschutt), Riffkern (massiger Kalkstein) und Rückriff (dunkel, häufig geschichtet) nachvollziehen.
Spätere geologische Ereignisse haben die Kalksteine vielfach verändert. So führten mehrfache hydrothermale Mineralisationen zur Bildung von Mineralgängen und an manchen Stellen zur Umwandlung von Kalkstein in Dolomitstein. Verwitterungsvorgänge unter tropisch-subtropischem Klima erzeugten vielfältige Karsterscheinungen wie Höhlen und Kegelkarst, bedingten aber auch Stoffumlagerungen, auf die Eisen-, Mangan- und Phosphoranreicherungen zurückgehen, die in früheren Jahrhunderten abgebaut wurden.
Die Exkursion führt in einen aktiven Kalkstein-Steinbruch sowie in mehrere stillgelegte Steinbrüche. Festes Schuhwerk zwingend erforderlich, Mittagspause im Restaurant.
Bus-Exkursion, Treffpunkt Schlossplatz, Abfahrt 8:00, Rückkehr gegen 19:00.
Kosten für Bus: 32 EUR, Anmeldung bis 25.08.2016
→ Zu dieser Veranstaltung ist ein Bericht verfügbar.
![Schlafmohn [Foto: I. van Rensen] 2016 vanRensen Schlafmohn](/images/veranstaltungen/2016/2016_vanRensen_Schlafmohn.jpg) Vortrag von Dr. Irmgard van Rensen
Vortrag von Dr. Irmgard van Rensen
Montag 10.10.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
![Fliegenpilz [Foto: I. van Rensen] 2016 vanRensen Fliegenpilz1](/images/veranstaltungen/2016/2016_vanRensen_Fliegenpilz1.jpg) Sie faszinieren uns, die Pflanzen, mit denen wir unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit verändern können. Erweitern sie unseren Horizont oder vergiften sie uns?
Sie faszinieren uns, die Pflanzen, mit denen wir unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit verändern können. Erweitern sie unseren Horizont oder vergiften sie uns?
Im Rahmen ihres Vortrags stellt Apothekerin Dr. Irmgard van Rensen die Wirkungsweise verschiedener pflanzlicher Inhaltsstoffe auf das Nervensystem vor und weist auch auf ihre Verwendung in verschiedenen Kulturen hin.
Ein Einblick in die aktuelle Pharmakologie und in die historische Verwendung dieser Pflanzen – erweitern Sie Ihr Wissen; eine Anleitung zur Erweiterung Ihres eigenen Bewusstseins werden Sie hier jedoch vergeblich suchen.
![Blasenfreies Quarzglas [Quelle J.Wetterau, Heraeus] 2016 Heraeus Qurazglas Bergkristall](/images/veranstaltungen/2016/2016_Heraeus_Qurazglas_Bergkristall.jpg) Vortrag von Dr. Jörg Wetterau
Vortrag von Dr. Jörg Wetterau
Mittwoch 19.10.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
Themen des Vortrages:
- Allgemeines zu Heraeus
- Historie von Heraeus bis heute (Heraeus im Wandel)
- Quarzglas bei Heraeus – vom Bergkristall zum Hightech-Produkt (über Eigenschaften und Besonderheiten sowie erste Anwendungen bis zur Hanauer Höhensonne)
- Quarzglas und Richard Küch – Küch legte die „Grundlage“ für unser heutiges Internet
- Wo spielt Quarzglas heute in unserem Alltag eine wichtige Rolle (Mikrochips und Glasfasern fürs Internet)?
- Was haben Quarzglas und Heraeus mit Albert Einstein zu tun? (Quarzglas für Spezialanwendungen und im Weltraum/Mond)
- Innovationen schaffen – wie Heraeus an der Welt von morgen „bastelt"
 Vortrag von Prof. Dr. Andreas Mehl
Vortrag von Prof. Dr. Andreas Mehl
Montag 07.11.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
Tiere wurden in der Antike immer wieder beschrieben und abgebildet: das einzelne Tier für sich, Tiere unterschiedlicher Arten zusammen in ihrem jeweiligen Lebensraum, Tier und Mensch sowie Tier und Gott und schließlich Tiere als Fabelwesen.
Anhand von Beispielen aus der antiken Literatur und bildenden Kunst soll gezeigt werden, was Griechen und Römer an Tieren interessierte, was ihnen als Besonderheit auffiel und was sie faszinierte oder erschreckte.
![Waldbild aus der Region [Foto C.Schaefer] Nachhaltigkeit](/images/veranstaltungen/2016/2016_Schaefer.JPG) Vortrag von Christian Schaefer
Vortrag von Christian Schaefer
Mittwoch 16.11.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
Das Etikett “Nachhaltigkeit“ schmückt heute Koalitionsvereinbarungen, Firmenbroschüren, Presseberichte. Der Vortrag beginnt mit den Anfängen des Begriffs in der Geburtsstunde moderner Forstwirtschaft in Mitteleuropa. Er beleuchtet den Wandel, den das Prinzip allein in der Forstwirtschaft in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat. Der Referent wird anhand von Beispielen aus dem Forstamt Hanau-Wolfgang die Elemente moderner nachhaltiger Forstwirtschaft illustrieren. Schließlich wird auf die Allgegenwärtigkeit des Begriffs in der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion eingegangen – ist er zum Schlagwort geworden und seiner Bedeutung beraubt?
![Egi Gletscher [Foto: M.Reichelt] 2016 Reichelt EgiGletscher](/images/veranstaltungen/2016/2016_Reichelt_EgiGletscher.jpg) Vortrag von Mathias Reichelt
Vortrag von Mathias Reichelt
Montag 05.12.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
Goethes Ballade „Der König von Thule“ wurde häufig im Deutschunterricht der Gymnasien behandelt. Aber wo liegt eigentlich das „sagenhafte“ Thule? Es liegt ganz im Norden von Grönland, der größten Insel der Welt.
Vor ein paar Jahren führte der Vortragende eine sechswöchige Reise zu acht verschiedenen Orten auf Grönland durch. Im Vortrag sollen historische, geographische, biologische und anthropologische Aspekte zu Grönland vorgestellt werden, die mit vielfältigen Bildern veranschaulicht werden.
Vortrag von Manfred Sattler
Mittwoch 14.12.2016, 19:30 Uhr, Kulturforum
![Feldhamster [Foto M.Sattler] Feldhamster DSC03634](/images/veranstaltungen/2016/Feldhamster_DSC03634.jpeg) Nicht ohne Grund wurde der Feldhamster 2016 von der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild zum Tier des Jahres gekürt. Die Bestände des einstmaligen Ernteschädlings sind dramatisch bundes- und europaweit zusammengebrochen und das endgültige Verschwinden dieser Tierart dürfte in Zukunft Realität werden, wenn nicht konsequent Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Nicht ohne Grund wurde der Feldhamster 2016 von der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild zum Tier des Jahres gekürt. Die Bestände des einstmaligen Ernteschädlings sind dramatisch bundes- und europaweit zusammengebrochen und das endgültige Verschwinden dieser Tierart dürfte in Zukunft Realität werden, wenn nicht konsequent Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Manfred Sattler von der Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz (AGF) referiert zur Lebensweise, Bestandssituation sowie den Gefährdungsursachen und erläutert Lösungswege, um den bunten Nager doch noch gemeinsam mit den Landwirten vom Aussterben zu bewahren.
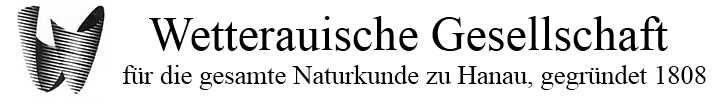
![Slowenien, Steiner Alpen, Logarska Dolina [Foto M.Schroth] Naturschätze in Slowenien und Kroatien](/images/veranstaltungen/2016/2016_Schroth_Foto02.JPG)
![Naturfaszination Lappland [Foto W.Malkmus] Lappland](/images/veranstaltungen/2016/2016_Malkmus_Foto02.JPG)
 Vortragstag am Samstag 09.04.2016
Vortragstag am Samstag 09.04.2016